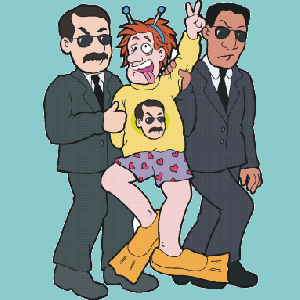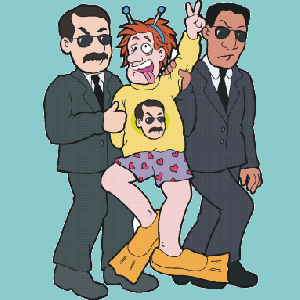| Die Gartenparty
Onkel Zieper trat aus seinem Haus und alle klatschten. Beschwichtigend
wehrte er mit einer Armbewegung ab. In seinem Garten vergnügten sich
an die fünfhundert Menschen, Männlein und Weiblein aber auch
viele Kinder. Für die Kleinen waren allerhand Spiele vorbereitet.
Die Kinder konnten Sackhüpfen, Eierlaufen und sich auf einem luftgefüllten
Ungetüm von Trampolin austoben. Auch gab es Gewinne, genauer gesagt
Gewinnchips. Die konnten die Kinder dann gegen Bonbons oder Eiskrem eintauschen.
Die Erwachsenen brauchten diesen Umweg nicht zu gehen. Wer kräftig
auf den Lukas haute, der bekam sofort einen Schnaps, und wessen Muskeln
zu schwach waren, der bekam zur Stärkung eine Schmalzstulle oder ein
Bratwürstchen. Überall im Garten kitzelte der Geruch von Gebratenem
die Nasen der Gäste. Auch konnten sich die durstigen Kehlen an drei
Bierständen laben. Als besondere Attraktion wurde ein Ochse am Spieß
gebraten, allerdings würde es noch eine Zeitlang dauern, bis der gar
war. Zieper mischte sich unters Volk, schüttelte Hände und hielt
manchen Plausch. Oft wurde gefragt, was es eigentlich zu feiern gäbe.
Aber er lachte dann nur, hob sein Glas und rief:
»Kinder, wir feiern aus Freude am Leben, kommt, laßt uns
noch einen heben!«
Natürlich hatte der alte Fuchs nur Wasser in seinem Glas. Er schritt
von Gruppe zu Gruppe, tätschelte Kinder und gab den Eltern guten Rat.
Längere Zeit unterhielt er sich mit Frau Schütze und sprach ihr
Trost zu, scherzte dann sogar mit ihr. Es gelang ihm doch tatsächlich,
die gute Frau zu einem herzhaften Lachen zu bringen. Eigentlich wäre
diese seelsorgerische Arbeit eine dankbare Aufgabe für die beiden
geistlichen Würdenträger gewesen, zu denen er sich jetzt gesellte.
Es war der evangelische Bischof Rudolf Freiangst aus Lichtstadt und die
evangelische Bischöfin Jutta Wegener aus Nordstadt. Der Herr Bischof
hielt ein großes Glas Bier in der einen Hand und in der anderen ein
Würstchen. Seine geistliche Kollegin enthielt sich solch irdischer
Freuden, sie nippte an einem Glas Wasser. Beide waren in einem anregenden
Gespräch vertieft. Onkel Zieper schnappte die Worte "gebetet" und
"Petrus" auf. Er wollte sich gerade wieder entfernen, niemals würde
er zwei Theologen in ihrem Gespräch stören, als er merkte, daß
die beiden sich nur übers Wetter unterhielten.
»Wer von Ihnen hat nun das wundervolle Wetter zu unserem Gartenfest
bestellt?« fragte er leutselig.
»Ich habe schon vorigen Sonntag für besseres Wetter gebetet,
aus Sorge um die Ernte«, sagte die Bischöfin.
»Und ich habe gestern meinen Teller ratzekahl leer gegessen«,
sagte der Bischof und schmunzelte, »und prompt hat das Schütten
aufgehört.«
»Gut, Sie haben gewonnen«, Zieper lachte und klopfte dem
Bischof mit der flachen Hand gegen den dicken Bauch, »passen Sie
bloß auf, daß nicht eine fürchterliche Dürre kommt!«
Die Frau Bischöfin fand das gar nicht so lustig. Sie kam aus dem
nördlichen Teil des Landes, dort sind die Leute sehr ernst, und in
religiösen Dingen versteht man keinen Spaß. Auch in weltlichen
Dingen nicht. Nein, alles muß seine Ordnung und Richtigkeit haben.
Onkel Zieper ging weiter, aber noch bevor er zur nächsten Gruppe stieß,
kam ihm die Erinnerung an eine Talkshow im Fernsehen in Erinnerung. Da
war die Bischöfin zu Gast gewesen.
»Wenn unsere obersten Richter urteilen, ich sei von Stund' an
ein Mann«, hatte sie tatsächlich gesagt, »dann beuge ich
mich ihrem Spruch und ohne mit der Wimper zu zucken, werde ich das Urteil
akzeptieren. Recht muß schließlich Recht bleiben. Gebt dem
Kaiser was des Kaisers ist.«
Und als dann die anderen Damen der Runde erschrocken die Hand zum Mund
geführt, und eine leise, aber mit kaum unterdrücktem Abscheu
gesagt hatte, dann müsse sie ja so ein Ding tragen, da hatte sie geantwortet:
»Jawohl, dann werde ich dieses Kreuz tragen und zwar mit erhobenem
Haupt. Noch einmal, Recht muß Recht bleiben! Im Übrigen bin
ich sicher, wenn man eine solch große, schwere Bürde auf sich
nimmt, wenn ich so geprüft würde, dann wäre ich auch reif
für andere, vielleicht höhere Aufgaben.«
Zieper wußte nur zu gut, mit diesen klaren Worten hatte die Bischöfin
allen Menschen im nördlichen Teil des Nord-Süd-Landes aus der
Seele gesprochen. Aber der Anruf einer alten Parteifreundin aus dieser
Gegend hatte ihn nachdenklich gestimmt. Nein, so könne es mit der
Jugend nicht weitergehen, hatte sie geklagt. Ihr achtjähriger Enkel,
der trotz der späten Stunde die Sendung gesehen hatte, dem war doch
tatsächlich ein absonderlicher Vergleich eingefallen.
»Ja, Oma«, hatte das Gör gesagt, »da muß
sich die Frau aber vorsehen. Sie ist jetzt schon Bischöfin, wird dann
sogar ein Bischof, aber bevor sie Papst wird, sitzt sie wieder in ihrem
alten Pott!«
Zieper ging weiter. Er entschied sich für ein kühles Bier
und hielt auf einen der Bierstände zu. Seine Vorfreude wurde durch
zwei Männer getrübt, die dort dem Gerstensaft zusprachen.
»Verflucht«, murmelte er in seinen Bart, »wer hat
denen die Eintrittskarten gegeben?«
Er meinte damit zwei Reporter des Lichtstädter Boten, einer Journaille
übelster Art. Zieper tat so, als sähe er die beiden nicht und
wollte stracks weitergehen. Aber die beiden Schreiberlinge hatte ihn bereits
erspäht. Also machte er gute Miene zum bösem Schrieb.
»Herr Zieper, Sie sprachen vorhin mit Frau Schütze. Wir
sahen, wie die Dame lachte. Hat sie Grund dazu?«
»Frau Schütze hatte euch beide für eine kurze Zeit
angeschaut, aber als sie ihren Blick wieder von euch abwandte, da hat sie
erkannt, wie schön das Leben doch sein kann. Spaß beiseite,
nein, ich konnte ihr nichts Neues sagen. Aber ich bin sicher, Schütze
wird bald aus dem Krankenhaus entlassen. Wer von euch beiden tut mir einen
Gefallen?«
»Ich«, riefen die beiden wie aus einem Mund.
»Wer denn nun? Ihr müßt euch schon einigen!«
Die beiden sahen sich an, der jüngere ließ dem älteren
Vortritt.
»Das ist aber nett Herr Liebenau, holen Sie mir doch bitte ein
Bier.«
Der wollte aber nun, daß sein Kollege gehen sollte. Wie bei den
Hunden, herrscht bei den Journalisten eine gewisse Rangordnung. Tatsächlich
verschwand der junge Kollege im Gewühl.
»Gut, daß wir jetzt unter uns sind», sagte Zieper
in geheimnisvollen Ton, »ich kann Ihnen eine Nachricht geben, die
dürfen Sie aber erst in drei Tagen bringen. Einverstanden?
Der Journalist nickte und stellte seine Lauscher auf Empfang.
»Unser Ministerpräsident tritt zurück«, flüsterte
Zieper.
»Wann? Wegen der Schachtel?«
»Nein, wegen der Toilette!«
Zieper freute sich über den dummen Ausdruck im Gesicht des anderen.
»Wieso Toilette?«
»Immer wenn Glander pinkelt, tritt er etwas zurück. Sie
etwa nicht?«
Ob er wollte oder nicht, der Reporter mußte mitlachen, es war
zwar gequält, aber immer hin.
»Was lacht ihr denn so?« fragte der andere Journalist,
als er Zieper das Bier reichte.
»Das ist geheim!« rief der Landesvorsitzende, ging mit
dem Glas in der Hand weiter und lief prompt in die Arme eines anderen Pressemenschen.
Der hatte es allerdings weit gebracht, der war Verleger. Aber was das Wichtigste
war, er war ein Freund des Landesvorsitzenden. Sie gingen ein Stück
abseits, so konnten sie ohne Zuhörer ein Wort wechseln.
»Eduard, sag', was ist der Grund für diese Feier?«
»Ich freue mich, und möchte, daß andere an meiner
Freude teilhaben. Ich hoffe doch, daß du dich amüsierst.«
»Und wie, nochmals vielen Dank für die Einladung.«
»Aber du machst so ein ernstes Gesicht. Hast du Sorgen?«
fragte Zieper.
»Ehrlich gesagt ja. Wenn du wüßtest, wie ich mich
über den Nord-Süd-Geist ärgere. Am Liebsten würde ich
das Blatt einstellen.«
»Nun übertreib' man nicht. Er ist wohl etwas in die Jahre
gekommen, du müßtest ihn 'mal gründlichst abstauben.«
Der Verleger schüttelte den Kopf.
»Nein, das ist nicht das Problem, darunter leidet eine ältere
Zeitung zwangsläufig. Öfters ist sogar ein neuer Besen durch
die Redaktionsräume gefahren, hatte auch manchen Staub aufgewirbelt.
Aber eben nur gewirbelt. Der Dreck hat sich dann immer wieder gesetzt und
ist dann in Bereiche gefallen, die vorher keines Abstaubens bedurft hätten,
jetzt jedoch wie Sand im Getriebe wirken.«
Dem Verleger gehörte die angesehene Zeitung ‚Nord-Süd-Geist‘.
Das war nicht etwa eine Fachzeitschrift für Spirituosen, nein, die
Zeitung unterwies das ganze Nord-Süd-Land in Sachen Kultur, war das
Bildungsblatt des Landes. Der Nord-Süd-Geist wollte in die Köpfe
der Menschen blitzen. Manchmal blitzte er nur selten, merkte nicht wie
die Zeit verging. Dann jedoch, um den Zeitgeist nicht zu verschlafen, blitzte
er so schnell, daß den Lesern das Blatt aus der Hand fiel. Eine alte
Studienrätin wußte plötzlich nicht mehr wie ihr geschah.
Zwar waren weiterhin die Wörter sehr gesittet, aber die Buchstaben
waren es, die aus der Reihe tanzten. Immer wieder war es das kleine f,
das nun groß geschrieben wurde. Dieser Buchstabe kitzelte die Dame
an Stellen, von denen sie vorher nicht gewußt hatte, daß die
existierten. Nein, an dem kleinem f nahm die Dame keinen Anstoß,
auch an dem großen nicht. Ganz im Gegenteil, jetzt hatte sie das
Gefühl, in der Vergangenheit beschnitten worden zu sein. Da sie jetzt
erwacht war, las sie unvoreingenommen in dem Blatt. Aber dem F folgte nicht
mehr das I. Dieser lustige Kumpan des F, früher stets an zweiter Stelle,
wollte nicht mehr mit von der Partie sein. Aus ihm hatte der Zeitgeist
ein U, klein und häßlich, an ein Toilettenbecken erinnernd,
gebogen. Und alles war so traurig, so unendlich melancholisch. Auch dem
Unternehmer, dessen Griff früher freudig dem Nord-Süd-Geist gegolten
hatte, nicht des Wirtschaftsteils wegen, nein, das wäre Zeitverschwendung
gewesen, dem Herrn wurde bei der Lektüre des Blattes angst und bange.
Wer läßt sich schon gern verstümmeln? Und alles war so
traurig, so unendlich melancholisch. Aber der Handwerker beklagte sich
nicht über das Blatt, wieso auch, er las es nicht. Jedoch einer der
klugen Schreiber des Nord-Süd-Geists, ein Redakteur des Feuilletons,
beklagte sich über ihn. Warum gibt es keine theologischen Hutmacherlehrlinge
mehr? Fragte er. Wo sind sie geblieben, die Jakob Böhme und Hans Sachs,
die mystischen Schuster und lyrischen Schuhmacher? Wo sind sie hin, die
philosophischen Sattler? Warum schreibt keiner dieser Handwerksgesellen
seine Reflektionen nieder? Was ist nur aus diesem Berufsstand geworden?
Der Herr Redakteur gab keine Antwort. Und alles war so traurig, so unendlich
melancholisch. Die alte Studienrätin jedoch, die las ihrem Kater,
den sie derweil an einer gewissen Stelle kraulte, den Leserbrief vor, den
sie der Zeitung schickte. Sie kannte die Antwort, schließlich war
sie gekitzelt worden. Damals, so schrieb sie, also zu Zeiten Spinozas,
Karl Philipp Moritz' oder um 1700, als Johann Dietz gelebt hatte, da wurden
nicht 40 Prozent eines Jahrganges zur Universität hingeführt.
Also mußten viele Begabten im Handwerk bleiben. Im Übrigen könne
sie sich noch gut an den kleinen Benno, der es jetzt sogar zu einem Redakteur
gebracht hatte, erinnern. Heute bereue sie ihre damalige Gutmütigkeit,
eigentlich hätte er durch das Abitur fallen müssen. Aber hatte
sie eine andere Wahl gehabt? Nein, aus dem Jungen wär' nie ein anständiger
Handwerker geworden. Auch dieser Brief wurde veröffentlicht, gekürzt
zwar, aber er sorgte für eine gewisse Aufregung.
»Ja«, klagte der Freund sein Leid, »täglich
erreichen mich nun 100 Briefe von empörten Lehrern und Funktionären
der GEW, alles treue Leser, Bildungsbürger. Die fragten, ob es das
Ziel des Nord-Süd-Geists sei, die damaligen unsozialen Zustände
wieder einzuführen. Aber es kam noch schlimmer. Ausgerechnet in derselben
Ausgabe erschien eine Besprechung über das Buch eines indischen Schriftstellers.
Und die dumme Kuh von Rezensentin mußte natürlich, nachdem sie
das Buch ordentlich gelobt hatte, einen Tropfen Wermut vergießen.
Ja, hat diese Idiotin geschrieben, was dem Schriftsteller eigentlich fehle,
sei die Erfahrung von gewaltsamer Entwurzelung und Exil. Natürlich
hatte sie in der Schule und auf der Uni gelernt, daß gerade Entbehrungen
den Geist schärfen und fette Leute keine anständigen Bücher
schreiben können. Aber ich bitte dich, so etwas als Deutsche, über
einen Inder, in meinem Nord-Süd-Geist zu verbreiten, das ist schon
ein starkes Stück. In einem Blatt, das vorwiegend von Leuten gelesen
wird, die die heile Welt propagieren und auch daran glauben. Für Leute,
die sich sozial engagieren. Für Menschen, die keinen Bettler sehen
können. Glaub mir Eduard, da gab es doch tatsächlich Beifall
von der falschen Seite. Ja, schrieb so ein Gestriger, uns Deutschen gehe
es wieder viel zu gut. Wir Germanen könnten nur während eines
Krieges richtige Leistung bringen, und allenfalls in Nachkriegsjahren wäre
unser Volk zu kulturellen Leistungen fähig. Es gab doch tatsächlich
eine Zuschrift, da wurde höhnisch gefragt, ob der Dame ein Mutant
nach einem Atomkrieg recht wäre. Er, der Leser, bastele gerade an
einer Atombombe und könne der Dame sicherlich helfen. Später
dann, also wenn das Leid und die Entbehrungen über die Welt gekommen
seien, dann wäre es allerdings am besten, die gute Frau lese direkt
aus dem Manuskript. Gewiß wären noch Eiterflecken vorhanden,
die dem Schriftsteller aus seinen radioaktiven Wunden geflossen seien.
Sag' mein lieber Freund, was soll ich bloß machen?«
»Ja, ich lese den Geist auch nur noch sehr selten, und dann lege
ich ihn meistens schnell wieder weg. Ich habe angst, ich könnte Depressionen
bekommen. Alles ist im Geist so traurig und unendlich melancholisch.«
»Es ist noch viel schlimmer«, sagte der Verleger, »in
einer Studie wurde festgestellt, daß man bei Bewerbungen für
Posten in der freien Wirtschaft nicht erkennen geben sollte, daß
man Leser des Geistes sei. Die Personalchefs sind sicher, daß langjährige
Leser des Geistes fürs Leben versaut sind.«
Zieper sah seinen Freund betroffen an, er kannte solche Erfahrungen
aus seiner Partei. Der Verleger aber fuhr fort:
»Und tatsächlich, wenn du die Stellenanzeigen des Geistes
liest, dann geht dir ein Licht auf. Bedenke, aus der Art der ausgeschriebenen
Stellen läßt sich auf die Struktur der Leser schließen.
Da werden Redaktionsassistenten, pädagogische Führungskräfte,
Betriebswirte mit pädagogischem Engagement, Referenten für Umweltpolitik,
ein Direktor für einen Wohnpark, der Geschäftsführer für
eine Landesagentur für Struktur und Arbeit, diverse Professoren und
Assistenten gesucht. Frag' mal, wer die Anzeigen aufgibt? Fast ausschließlich
sind es Behörden, also mehr oder weniger öffentliche Arbeitgeber.
Die wissen natürlich von der parteipolitischen Verschiebung von Stellen,
von diesem Filz, diesen Sumpf von Korruption. Und die Stellensuchenden
wissen es auch. Das sind die heutigen Leser des Geistes. Das sind keine
Arbeiter oder junge Handwerker, die im zweiten Bildungsweg das Abitur machen.
Auch der Ingenieur und Abteilungsleiter, der Zusammenhänge der Wirtschaft
lernen möchte, und den man über einen anständigen Wirtschaftsteil
dazu bringen könnte, auch mal ins Feuilleton zu schauen, liest den
Nord-Süd-Geist nicht. Was aber das Schlimmste ist, auch die Studienrätin
läßt unser Blatt fallen, und für die wenigen Literaten
zählen wir schon lange nicht mehr.«
Onkel Zieper wußte auch keinen Rat. Und alles war so traurig,
so unendlich melancholisch. Aber Gott sei Dank hatte er ja ein Glas Bier
in der Hand. Er nahm einen tüchtigen Schluck und schon ging es ihm
besser.
Auch andere seiner Parteifreunde hatten dem Alkohol zugesprochen, überall
wurde die Stimmung ausgelassener, ja man bildete sogar Polonäsen.
Dieses Spiel war in der Partei sehr beliebt, einmal wegen des Körperkontaktes,
also des Schulterschlusses, und zweitens, weil diese Formation eine Einheit
bildet. Allerdings kam es öfters vor, daß eine solche Schlange
zerriß. Entweder einigte man sich nicht auf den Kopf, oder es ging
zu rasant um die Kurven, so daß der Schwanz nach heftigster Bewegung
abriß. Schlimm war es, wenn in zwei Richtungen gezogen wurden. Besonders
für die in der Mitte wurde es dann gefährlich. Drei Schritte
ging es nach links und ehe man sich versah, wieder vier nach rechts, oder
auch umgekehrt. Mancher brach sich bei diesem kopflosen Gestolper ein Bein,
bekam aber zumindest blaue Flecken, die sich neuerdings immer grün
färbten. An die fürchterlichen Gebilde mit drei Köpfen mochte
Onkel Zieper nicht denken, nein, bloß das nicht wieder! Er stand
an einem der verwaisten Biertische und fütterte die riesige Schlange,
Glas auf Glas reichte er seinen Freunden, die Stimmung stieg. Und dann
kam es wie es kommen mußte, die Polonäse zerbrach in mehrere
Stücke. Viele Freunde standen plötzlich herum und wußten
nicht, wo sie sich anschließen sollten. Zwei mächtige, hungrige
Schlangen hatten sich gebildet, beide waren auf Beute aus. Fröhlich
winkend gingen sie auf ihre Opfer zu, und ehe sich ein unschuldiges Lehrerlein
versah, war es umringt, war gefangen in einem Kreis. Onkel Zieper kannte
dieses Spiel mit den Kreisen. Er selbst hatte vor Jahren den Meerheimer
Kreis ins Leben gerufen. Jetzt im Alter wußte er, wie gefährlich
das Spiel mit diesen Ringen ist. Selbst die Ringvereine zu Zeiten des guten,
alten Zille, aus denen sich manch anständiger Gewerkschaftler gehäutet
hatte, waren verschwunden. Immer wieder hatte Zieper seinen Parteifreunden
den Rat gegeben, onaniert öffentlich, schlagt eure Kinder, vergewaltigt
eure Frauen - aber hört mit den Kreisen auf. Er konnte das fürchterliche
Schauspiel nicht ertragen, wandte sich ab, nahm einen tiefen Zug Gerstensaft,
schloß die Augen, hielt sich die Ohren zu und schrie aus Leibeskräften:
»Ich will davon nichts wissen, ich will davon nichts wissen..«
Und ein Wunder geschah, die Schlangen zerplatzten und seine Freunde
ließen ab von diesem bösen Spiel. Über Onkel Ziepers Gesichtszüge
huschte ein zufriedenes Lächeln. Mit dem Glas in der Hand ging er
weiter, niemand beachtete ihn. In die Nähe des Hintereinganges seines
Grundstücks setzte er sich unter einem Fliederbusch auf eine alte
Bank. Er erwartete den wichtigsten Gast des Tages.
Er mochte ungefähr eine Viertelstunde dort gesessen haben, da
hörte er Klappen von Autotüren. Einen Augenblick später
schüttelte er dem Ministerpräsidenten des Nord-Süd-Landes
die Hand. Den Parteifreunden freundlichst zuwinkend gingen die beiden Arm
in Arm durch den Garten. Wie von Zauberhand bildete sich eine Gasse. Vor
dem sich noch immer drehenden Ochsenbraten blieben sie stehen. Ein Jagdhorn
erschallte, der Spieß hielt an, Fett tropfte zischend in die Holzkohlenglut.
Onkel Zieper band Glander eine Schürze um und drückte ihm ein
großes Messer sowie eine überdimensionale Gabel in die Hand.
Als das Horn wiederum erscholl, schritt Glander zur Tat. Jedermann sah,
wie dieser Mann Hand anzulegen verstand. Mit einigen beherzten Schnitten
trennte der Ministerpräsident ein großes Stück Fleisch
ab. Auf einem Holzblock zerteilte er es in personengerechte Portionen,
wickelte die Leckerbissen gekonnt in Stücke von dünnem Fladenbrot,
und als das Horn das dritte Mal ertönte, reichte er die Gaben den
um ihn herum stehenden Freunden. Alle klatschten Beifall, die Parteifreunde
freuten sich über ihren Ministerpräsidenten, waren begeistert
von dessen Ausstrahlung und Tatkraft. Mit diesem Mann würde die Partei
jede Wahl gewinnen. Glander lächelte huldvoll, und auch er selbst
biß in eins der vom Brotteig umhüllten Fleischstücke. Unversehens
liefen ihm die Tränen herunter, er hatte sich verbrannt. Die Parteifreunde
jedoch waren sicher, es waren Tränen der Rührung über den
von ihnen gespendeten Beifall und klatschten um so mehr.
Zieper und seiner hoher Gast tranken ein, zwei Biere, dann führte
der Landesvorsitzende den Ministerpräsidenten in sein Haus. Im Wohnzimmer
saßen zwei Personen, die sich sofort erhoben. Glander erkannte Ziepers
Patenkind, seine Sekretärin Rita Himmelreich. Der neben ihr stehende
Mann war ihm unbekannt.
»Mein lieber Horst, meine Nichte Rita kennst du ja«, sagte
Zieper und wies mit einer wohlwollenden Geste auf den Mann, »und
das ist Herr Dr. Jochen Hubert. Den Herrn möchte ich dir besonders
ans Herz legen, er hat sich heute mit Rita verlobt.«
Einen Augenblick verschlug es Glander die Sprache, auch er hatte mit
Rita geschlafen. Dann aber lächelte er, schüttelte den Verlobten
artig die Hände und wünschte dem Paar viel Glück. Ehe er
noch weiteres von sich geben konnte, zog ihn Onkel Zieper, die beiden jungen
Leute allein lassend, in ein anderes Zimmer. Als die beiden nach fünf
Minuten wieder aus dem Haus traten und sich unter die anderen Gäste
mischten, lag um Onkel Ziepers Mund ein befriedigendes Lächeln. Der
zukünftige Ehemann und Vater hatte eine glänzende Karriere vor
sich. In einer Woche würde er zum Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes
im Nord-Süd-Land ernannt werden.
copyright ach-satire.de (Auszug aus dem Roman "Der Milliardenvirus")
Zur Startseite von ach-satire.de
|